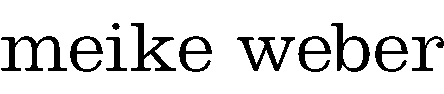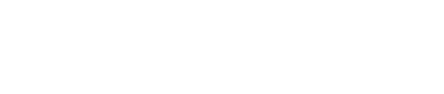Klima und Ressourcen schonende Bauwende – Neuausrichtung an den planetaren Grenzen
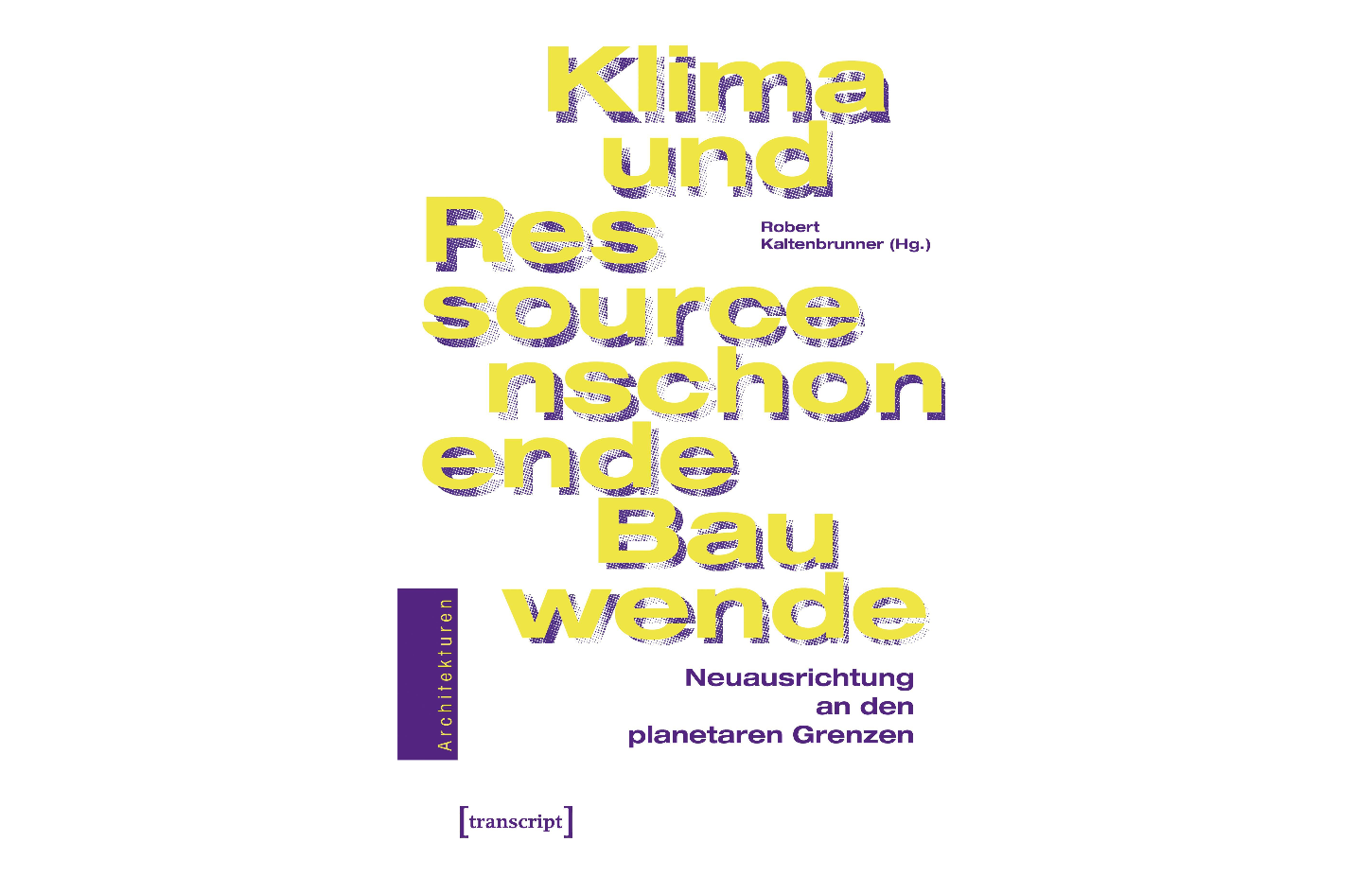
Robert Kaltenbrunner, Initiator und Herausgeber der aktuell post mortem im transcript Verlag erschienenen Publikation, war auch von mir persönlich ein hoch geschätzter Kollege im BBSR, geprägt von aussergewöhnlicher Klugheit und Kreativität, einem mitreissenden Humor und nicht zuletzt ein brillanter Freigeist, der leider im Februar diesen Jahres viel zu früh von uns ging.
Als Initiator hat er hier auf 200 Seiten den Raum geschaffen, Zukunftsthemen kritisch zu entwickeln und weiterzudenken.
Im ersten Kapitel widmet sich Robert Kaltenbrunner selbst dem Thema Reparaturarbeit, die Architektur braucht ein Reset. Es geht um Architektur im gesellschaftlichen und politischen Kontext, die Rolle des Bestands, um Suffizienz und Langlebigkeit, um Vereinfachung und regionale Bauweisen, um Kreisläufe, um Wiederverwenden und Weiterverwenden, um eine neue Relevanz der Denkmalpflege, um eine Bauwende im Sinne von, Bauen völlig neu zu denken – um ein Reset im bekannten Sinne des Wortes.
Im zweiten Kapitel beschäftigen sich die Autor*innen Nicolai Domann, Arnd Rose, Svenja Binz, Juliane Jäger und Jörg Lammers mit der Frage: Auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand? Hier geht es um politische Zielsetzungen, bisherige einseitige Maßnahmenentwicklungen, um den Gebäudesektor und das Handlungsfeld Gebäude, um Quell- oder Verursacherprinzip, Vor- und Nachteile von Bilanzierungssystematiken, um den Lebenszyklus von Gebäuden als auch um politische Instrumente im Handlungsfeld Gebäude und deren Lücken.
Im dritten Kapitel beschäftigen sich die Autor*innen Svenja Binz, Juliane Jäger und Jörg Lammers damit: Was bedeuten die plantaren Grenzen für den Gebäudebestand? Es geht um die 9 Umweltdimensionen für einen sicheren Handlungsraum für die Menschheit wie Klimawandel, Biodiversität, Veränderung der Landnutzung, biogeochemische Kreisläufe, neuartige Substanzen und modifizierte Lebensformen sowie pflanzenverfügbares Wasser. Es geht weiter um Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch und um eine mögliche Pro-Kopf-Budgetierung.
Im vierten Kapitel stellen Katja Hasche, Annika Hock, Jörg Lammers, Michael Lautwein, Ralf Schüle und Julia Siedle die Frage: Welchen Beitrag kann Suffizienz zum klima- und ressourcenschonenden (Nicht-)Bauen leisten? Es geht um die bislang fehlende Systematik und ihre Hintergründe, um die Aspekte der Suffizienz wie Fläche, Material, Bestand statt Neubau, Wiederverwendung und Recycling, Langlebigkeit, Energie und um entsprechende Suffizienzstrategien zu den Einzelaspekten sowie Handlungsfelder einer Suffizienzpolitik.
In Kapitel 5 beschäftigen sich Svenja Binz und Juliane Jäger mit der Fragestellung: Wie kann Klima- und Ressourcenschonung im Handlungsfeld Gebäude nachgewiesen werden? Hier geht es darum, dass eine Reduktion auf CO2 und THG dabei zu kurz greift. Es geht um Lebenszyklusbetrachtung statt Quellprinzip, das nur die Betriebsphase fokussiert und um Ökobilanzierung als sinnvolles Werkzeug.
Im sechsten Kapitel zeigen die beiden Autorinnen dies an einer Case Study und einem Diskussionsvorschlag einer praktikablen Gebäudebewertung auf.
Das abschliessende siebte Kapitel liefert die folgenden Handlungsempfehlungen an Politik und alle am Bauen Beteiligten:
1. Aktivitäten im Bauwesen müssen an den planetaren Grenzen ausgerichtet sein.
2. Nationale verfügbare Emissions- und Ressourcenbudgets müssen Leitplanken für politische Strategien und Entscheidungen sein.
3. Statt „Klimaneutralität“ muss eine einheitliche Definition und Berechnungsgrundlage von klima- und ressourcenschonendem Bauen Konsens werden.
4. Der gesamte Lebenszyklus des Gebäudes muss bewertet werden, wenn Klima- und Ressourcenschonung im Handlungsfeld Gebäude nachgewiesen werden soll.
5. Daten zu Klima und Ressourcenwirkpotentialen müssen eindeutig erfasst, transparent dargestellt und evaluiert werden.
6. Klima- und Ressourcenschonung muss von der Gebäude- auf die Betrachtungsebene des Quartiers erweitert werden.
7. Das Potential von Suffizienzmassnahmen muss in der Planungspraxis anerkannt und umgesetzt werden.
8. Wieviel ist genug? Beschleunigte Umsetzung der geplanten Netto-Null-Versiegelung und einer reduzierten Neubautätigkeit.
9. Baukultur, Klima- und Ressourcenschonung müssen zusammen gedacht werden.
10. Beteiligungsprozesse als Schlüssel für einen sozial-ökologischen Transformationsprozess im Baubereich.